Es gibt Stellen in der Musik, die sind vor Glück kaum auszuhalten. Wie der Beginn des Rondo in Beethovens viertem Klavierkonzert, wenn mit dem Orchestereinsatz die ganze Welt zu tanzen beginnt. Da kann auch der Dirigent Andris Nelsons kaum mehr an sich halten: ballt die Fäuste, hüpft auf dem Podium und freut sich wie ein Kind. Und das wirkt kein bisschen aufgesetzt bei dem 33-jährigen Letten, der bei seinem Landsmann Mariss Jansons in die Lehre gegangen ist und sich als Chefdirigent des City of Birmingham Symphony Orchestra aufmacht, in die Weltliga der Dirigenten aufzusteigen. Anders als der einstiger Leiter des Orchesters, Simon Rattle, ist Nelsons ein Emphatiker, der sich völlig verausgabt in dem Bemühen, noch das letzte Quentchen Ausdruck aus der Partitur zu holen. Spannung, Schwung, Fluss, innere Bewegtheit lauten lauten die Maximen seines Musizierens – auch bei Beethovens viertem Klavierkonzert. Zwar drohte ihm die Themenexposition im ersten Satz formal etwas aus den Fugen zu geraten, aber das änderte sich mit dem Einsatz des Pianisten Rudolf Buchbinder. Man konnte sich ja im Vorfeld fragen, wie der Hitzkopf Nelsons sich mit der sonst eher bedächtigen Art Buchbinders arrangieren würde. Aber so wie der Dirigent den technisch absolut brillant spielenden Pianisten zu einigen ungewohnten Keckheiten animierte, so bewahrte der souverän disponierende Buchbinder Nelsons immer wieder vor der Gefahr des Überphrasierens.
Schon beim Auftaktstück, Benjamin Brittens „Four Sea-Interludes“ aus der Oper Peter Grimes, konnte das Orchester bei seinem Gastspiel in der Meisterkonzertreihe mit seiner ausgeprägten Fähigkeit zu klanglicher Suggestion überzeugen: dräuend der dunkel-verhangene Beginn in „Dawn“, festlich gestimmt der „Sunday Morning“, mysteriös das „Moonlight“. Im finalen „Storm“ schließlich ließ Nelsons die Elemente nach Kräften toben.
Doch auch wenn das Orchester aus Birmingham sehr diszipliniert spielt – klanglich ist es von einem wirklichen Spitzenorchester noch ein gutes Stück entfernt. Das gilt weniger für das strahlend-satte Blech als vielmehr für die mitunter etwas scharf klingenden Holzbläser, auch der Streichersektion fehlt in der Höhe jener goldene Glanz, den etwa die Konkurrenz aus London oder Berlin aufzuweisen hat.
Freilich beeinträchtigte das die großartige Wirkung von Sibelius´ zweiter Sinfonie nur wenig. Nelsons malte das Stück als pessimistisch getöntes Erlösungsdrama, als schlingernden Psychotrip einer zerrissenen Seele, mit schimärenhaft aufscheinenden Inseln der Seligkeit inmitten des orchestralen Strudels. Sogar die triumphale Schlussapotheose, die vom Publikum im voll besetzten Beethovensaal bejubelt wurde, wirkte nach all den durchlebten Abgründen fast schon mahlerhaft gebrochen. Ein Leonard Bernstein hätte das kaum eindringlicher zeigen können. (Stuttgarter Zeitung)

Kristian Bezuidenhout Photo: Marco Borggreve
Geltungsbedürftigen Pianisten dürfte das eher nicht gefallen: anstatt – wie bei den meisten romantischen Klavierkonzerten – gleich thematisch markant einzusteigen zu können, muss man als Solist in Schumanns Introduktion und Allegro appassionato G-Dur op. 92 erst mal einige lange Takte das Orchester mit Arpeggien begleiten. Wieviel innere Erregtheit sich diesen Akkordflächen freilich abgewinnen und welch romantisch gespannter Tonfall sich damit evozieren lässt, das zeigte beim Konzert des Freiburger Barockorchesters im schwach besuchten Beethovensaal der Fortepianospieler Kristian Bezuidenhout. Der gebürtige Südafrikaner gilt aktuell als der Shootingstar unter der Hammerklavierspielern, seine Einspielungen mozartscher Klavierwerke haben sogar manchem eingefleischten Steinwayfan die Ohren dafür geöffnet, dass mit dem Zugewinn an Brillanz und Lautstärke beim modernen Flügel auch ein Verlust an klangfarblichen Gestaltungsmöglichkeiten einherging.
Das gilt durchaus auch für Schumann. Und gerade weil der Klaviersatz hier virtuoser und dichter ist als bei Mozart, so zwingt die dynamische Beschränktheit des Hammerflügels den Solisten geradezu, Ausdruck in der Phrasierung und agogischen Gestaltung zu suchen. Und das ist Bezuidenhouts Domäne: technisch absolut sattelfest, suchte er auch in solistischen Passagen nach Differenzierung. Immer auf Durchhörbarkeit bedacht, setzte er überraschende Akzente, baute kleine Verzögerungen und Beschleunigungen ein und beleuchtete den schumannschen Satz aus der Perspektive eines rhetorisch gewandten Erzählers, der nicht laut werden muss, um seine Zuhörer zu fesseln.
Vielleicht hätte sich ja Pablo Heras-Casado am Pult des FBO ein Beispiel daran nehmen können. Selbst wenn der golden lasierte Klang des FBO bei Schumann eine ideale Ergänzung zu den schillernd-gedämpften Glockentönen des Hammerflügels darstellte, so suchte Heras-Casado sein Heil doch allzuoft in einer extrovertierten, mitunter sehr äußerlich wirkenden Emphase. Schlaglichtartige Charakterisierung von Phrasen trat dabei immer wieder an die Stelle des Aufbauens größerer Sinneinheiten, was schon in der Durchführung des ersten Satzes von Schuberts vierter Sinfonie zu einem Zerfasern des sinfonischen Gewebes führte. Das spieltechnische Potential der Freiburger verhinderte da zwar noch das Schlimmste, aber in Mendelssohns Sinfonie Nr. 4 A-Dur, der „Italienischen“, half auch das nicht mehr viel. Derart rhythmisch konfus und schlampig phrasierend hat man das FBO kaum einmal gehört wie im letzten Satz dieser Sinfonie, der Heras-Casado im Andante (das hier ein Allegretto war) auch noch den melancholischen Zauber ausgetrieben hat. „Die blaue Blume“ war das Konzert überschrieben. Heras-Casado muss noch etwas nach ihr suchen. (Stuttgarter Zeitung)
Orkan im Frühling
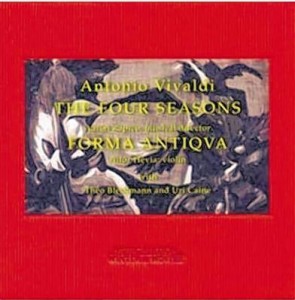 Vor 25 Jahren hätte man eine solche Aufnahme noch als das Werk von Verrückten abgetan. Der Beginn des Winters in dieser Neuaufnahme von Vivaldis „4 Jahreszeiten“ durch das spanische Ensemble Forma Antiqva etwa klingt in der Geräuschhaftigkeit, mit der die Streicher hier mehr auf als am Steg spielend die vor Kälte klirrende Landschaft evozieren, eher wie ein Stück neuer Musik als wie ein barockes Concerto grosso, der Frühlingssturm bläst gar als veritabler Orkan aus den Boxen. Man kann die Interpretationsgeschichte dieses Dauerbrenners unter den Vorzeichen historischer Aufführungspraxis durchaus als eine der Steigerung betrachten – mit immer extremeren Tempi und einer zunehmend naturalistischer werdenden Darstellung von Außermusikalischem wie Hundegebell oder Vogelrufen. Unter diesem Aspekt könnte diese Aufnahme nun das vorerst letzte Kapitel dieser Entwicklung sein, denn mehr Virtuosität und klangfarbliche Zuspitzung lässt sich dem Instrumentarium kaum noch abtrotzen. Auch was Agogik und Phrasierung anbelangt, dehnt das Ensemble um das spanische Brüdertrio Aarón, Daniel und Pablo Zapico hier die Partitur bis an die Grenzen aus – mitunter scheint sich der Rhythmus fast in freie, fast improvisatorisch wirkende Passagen aufzulösen. Eine in ihrer Radikalität und theaterhaft plastischen Darstellung nachhaltig faszinierende Einspielung. Möglich wurde sie durch eine extrem reduzierte Streicherbesetzung , kontrastiert von einem vergleichsweise üppig besetzten Continuo und gekrönt vom wie entfesselt spielenden Solisten Aitor Hevia. Streiten kann man sich über die musikalischen Einrichtungen der Sonette, die Vivaldi den einzelnen Sätzen vorangestellt hat und die von Uri Caine unter Zuhilfenahme elektronischer Klangerzeuger vertont wurden. Originell ist diese Aufnahme ohnehin.
Vor 25 Jahren hätte man eine solche Aufnahme noch als das Werk von Verrückten abgetan. Der Beginn des Winters in dieser Neuaufnahme von Vivaldis „4 Jahreszeiten“ durch das spanische Ensemble Forma Antiqva etwa klingt in der Geräuschhaftigkeit, mit der die Streicher hier mehr auf als am Steg spielend die vor Kälte klirrende Landschaft evozieren, eher wie ein Stück neuer Musik als wie ein barockes Concerto grosso, der Frühlingssturm bläst gar als veritabler Orkan aus den Boxen. Man kann die Interpretationsgeschichte dieses Dauerbrenners unter den Vorzeichen historischer Aufführungspraxis durchaus als eine der Steigerung betrachten – mit immer extremeren Tempi und einer zunehmend naturalistischer werdenden Darstellung von Außermusikalischem wie Hundegebell oder Vogelrufen. Unter diesem Aspekt könnte diese Aufnahme nun das vorerst letzte Kapitel dieser Entwicklung sein, denn mehr Virtuosität und klangfarbliche Zuspitzung lässt sich dem Instrumentarium kaum noch abtrotzen. Auch was Agogik und Phrasierung anbelangt, dehnt das Ensemble um das spanische Brüdertrio Aarón, Daniel und Pablo Zapico hier die Partitur bis an die Grenzen aus – mitunter scheint sich der Rhythmus fast in freie, fast improvisatorisch wirkende Passagen aufzulösen. Eine in ihrer Radikalität und theaterhaft plastischen Darstellung nachhaltig faszinierende Einspielung. Möglich wurde sie durch eine extrem reduzierte Streicherbesetzung , kontrastiert von einem vergleichsweise üppig besetzten Continuo und gekrönt vom wie entfesselt spielenden Solisten Aitor Hevia. Streiten kann man sich über die musikalischen Einrichtungen der Sonette, die Vivaldi den einzelnen Sätzen vorangestellt hat und die von Uri Caine unter Zuhilfenahme elektronischer Klangerzeuger vertont wurden. Originell ist diese Aufnahme ohnehin.
Antonio Vivaldi: Die vier Jahreszeiten. Winter & Winter.
Transparent im dichtesten Gestrüpp
 Eigentlich gibt es kaum einen Grund, weshalb man Bachs Cembalo- oder Violinwerke ausgerechnet auf der Gitarre spielen sollte. Die Zahl überzeugender Originalaufnahmen ist groß und Transkriptionen von fremder Hand haftet leicht der Verdacht des Epigonalen an. Andererseits sind in den letzten Jahren einige Gitarreeinspielungen von Bachs Werken für Solovioline entstanden, denen man durchaus künstlerische Autonomie bescheinigen kann, etwa die Aufnahmen von Frank Bungarten für das Label Dabringhaus&Grimm. So war es wohl nur eine Frage der Zeit, wann sich der erste Gitarrist an die bachschen Solokonzerte wagen würde. Die in China geborene und in London lebende Gitarristin Xuefei Yang hat nun gleich drei davon für ihr Instrument eingerichtet – ein heikles Unterfangen, das man aber insgesamt als gelungen bezeichnen kann. Zwar hat sie ihr im Programmhefttext formuliertes Ziel, die Stücke so klingen zu lassen, als seien es „eigenständige Gitarrenwerke“ in ihrer Einrichtung des Cembalokonzerts BWV1052 verfehlt: zuviel sträubt sich da unüberhörbar gegen die Idiomatik der Gitarre. Dennoch: Mit welch technischer Bravour Xuefei Yang die horrenden Schwierigkeiten dieser Bearbeitung meistert, ist spektakulär. Selbst im dichtesten polyfonen Gestrüpp bleibt ihr Spiel transparent und schlüssig durchphrasiert, die solistische Besetzung des Orchestersatzes mit dem Elias String Quartet trägt das ihre zum lichten Gesamteindruck bei. Deutlich entspannter gelingen ihr die Violinkonzerte BWV1041 und BWV 1042, die über weite Strecken tatsächlich klingen, als hätte Bach sie für sechs Gitarrensaiten geschrieben. Und nur im Presto der ebenfalls eingespielten Sonate BWV1001 erliegt Yang einer alten Gitarristenkrankheit: die irre flinken Finger laufen da mitunter schneller, als es das Metrum verträgt.
Eigentlich gibt es kaum einen Grund, weshalb man Bachs Cembalo- oder Violinwerke ausgerechnet auf der Gitarre spielen sollte. Die Zahl überzeugender Originalaufnahmen ist groß und Transkriptionen von fremder Hand haftet leicht der Verdacht des Epigonalen an. Andererseits sind in den letzten Jahren einige Gitarreeinspielungen von Bachs Werken für Solovioline entstanden, denen man durchaus künstlerische Autonomie bescheinigen kann, etwa die Aufnahmen von Frank Bungarten für das Label Dabringhaus&Grimm. So war es wohl nur eine Frage der Zeit, wann sich der erste Gitarrist an die bachschen Solokonzerte wagen würde. Die in China geborene und in London lebende Gitarristin Xuefei Yang hat nun gleich drei davon für ihr Instrument eingerichtet – ein heikles Unterfangen, das man aber insgesamt als gelungen bezeichnen kann. Zwar hat sie ihr im Programmhefttext formuliertes Ziel, die Stücke so klingen zu lassen, als seien es „eigenständige Gitarrenwerke“ in ihrer Einrichtung des Cembalokonzerts BWV1052 verfehlt: zuviel sträubt sich da unüberhörbar gegen die Idiomatik der Gitarre. Dennoch: Mit welch technischer Bravour Xuefei Yang die horrenden Schwierigkeiten dieser Bearbeitung meistert, ist spektakulär. Selbst im dichtesten polyfonen Gestrüpp bleibt ihr Spiel transparent und schlüssig durchphrasiert, die solistische Besetzung des Orchestersatzes mit dem Elias String Quartet trägt das ihre zum lichten Gesamteindruck bei. Deutlich entspannter gelingen ihr die Violinkonzerte BWV1041 und BWV 1042, die über weite Strecken tatsächlich klingen, als hätte Bach sie für sechs Gitarrensaiten geschrieben. Und nur im Presto der ebenfalls eingespielten Sonate BWV1001 erliegt Yang einer alten Gitarristenkrankheit: die irre flinken Finger laufen da mitunter schneller, als es das Metrum verträgt.
Xuefei Yang. Bach Concertos. EMI Classics.

Michael Alber Bild: Martin Siegmund
In den letzten Tagen habe ihn dann doch „der Blues ereilt“, sagt Michael Alber. Gestern leitete er seine letzte Probe mit dem Stuttgarter Staatsopernchor, am Sonntag wird er bei Bellinis „La Somnambula“ zum letzten Mal einen Abenddienst absolvieren. Dann ist Schluss, endgültig. Nach 19 Jahren am Stuttgarter Haus, zunächst als stellvertretender und dann als leitender Chordirektor, übernimmt der gebürtige Tuttlinger ab dem Sommersemester 2012 eine Professur für Chorleitung an der Musikhochschule in Trossingen. Alber gibt zu, das ihm diese Entscheidung sehr schwer gefallen ist („ein halbes Jahr schlaflose Nächte“), und das ist nun auch wirklich kein Wunder. Er verlässt er den wohl erfolgreichsten und besten Opernchor der Republik zu einem Zeitpunkt, als sich das Stuttgarter Opernhaus unter dem neuen Führungsduo Wieler/Morabito aufmacht, nach den durchwachsenen Puhlmann-Jahren wieder zu einstiger Größe zu finden. Andererseits: der Mann braucht die Herausforderung. Schnelle Erfolge interessieren ihn nicht, sagt Alber, und dazu passt, dass er auf die Frage nach seinen schönsten Erinnerungen ausgerechnet jene Produktionen aufzählt, bei denen der Chor bis an die Grenzen gefordert wurde: Schönbergs „Moses und Aron“ oder Thomallas „Fremd“, aber auch „Actus tragicus“, bei dem die Sänger im Bach-Stil singen mussten.
Aber bis zur Verrentung an einem Haus zu bleiben, das kann sich Michael Alber nun wirklich nicht vorstellen. Zumal er durch seine geregelte Lehrtätigkeit nun auch die Möglichkeit bekommt, verstärkt Gastdirigate anzunehmen. Einiges steht jetzt schon auf seiner Agenda: ein Brahmsrequiem mit Kurt Masur in Paris, ein Cage-Projekt mit dem Ensemble Ascolta, CD-Aufnahmen mit dem Orpheus-Vokalensemble. Langweilig wird ihm nicht werden.
An seine Anfänge im Stuttgarter Opernhaus kann sich Michael Alber noch sehr gut erinnern. Es war 1992, als er zu seiner Bewerbung für die Stelle als stellvertetender Chordirektor Teile aus Wagners „Parsifal“ („Die Blumenmädchen begleitete ich selber am Klavier“) und Berlioz´ „La Damnation de Faust“ vorbereitet hatte, drei Tage vor dem Probedirigat wurde ihm noch den Anfang von Verdis „Otello“ aufgegeben – ein Chorleiter an einem Opernhaus muss stressresistent sein. Sein erster Abenddienst war dann gleich ein harter Brocken, Janaceks „Aus einem Totenhaus“, dirigiert von Michael Gielen. Hier mussten diverse Männerchöre disponiert werden, was auch Alber gehörig ins Schwitzen brachte. Seine erste eigene Produktion war dann 1995 Rossinis „L´Italiana in Algeri“, damals inszenierten Jossi Wieler und Sergio Morabito. Am Pult des Staatsorchesters stand eben jener Gabriele Ferro, der nun am Sonntag auch Albers Abschiedsvorstellung dirigieren wird: Bellinis „La Somnambula“, die bekanntlich ebenfalls von Wieler/Morabito in Szene gesetzt wurde. So schließt sich ein Kreis.
Immer wieder dazulernen – das zählt zu Albers Maximen. Und das müssen auch die Mitglieder des Opernchors. Vor allem stilistische Vielseitigkeit wird von ihnen erwartet. Was man von keinem Solisten verlangen würde – beispielsweise, gleichzeitig Wagner und Monteverdi singen zu können – zählt für Choristen zur Grundqualifikation. Dazu sollen Chorsänger auch szenisch überzeugen und sich auf die Vorstellungen der jeweiligen Regisseure einlassen. Nicht immer geht das ohne Reibungen. Da musste dann auch Alber, der mit den Choristen sonst ein „Verhältnis auf Augenhöhe“ bevorzugt, einfach mal entscheiden, was wie gemacht wird.
Alber verlässt, das ist sicher, ein bestens bestelltes Haus. Im letzten Jahr ist der Staatsopernchor wieder zum Opernchor des Jahres gewählt worden, zum achten Mal insgesamt. Auch in diesem Jahr dürften die Chancen dafür nicht schlecht stehen. Der Chor besitzt ein eigenes Profil, das sich vor allem durch klangliche Homogenität und Variabilität auszeichnet. Derart strahlend-satte Wagnerchöre wie in Stuttgart hört man anderswo kaum, wo nötig, kann der Chor aber auch kantabel und fein klingen. Das solistische Potential der Chorsänger ist ebenfalls imponierend – Produktionen wie Hans Thomallas „Fremd“ sind so überhaupt erst möglich geworden. Hier hat es sich ausgezahlt, dass Michael Alber in Besetzungsfragen kompromisslos war und eine Stelle auch mal ein Jahr unbesetzt gelassen hat, bis der perfekte Bewerber gefunden war.
Wenn Michael Alber nun geht, so hat er insgesamt 69 Operneinstudierungen hinter sich, dazu diverse Sinfoniekonzerte und CD-Produktionen, 27 Chorstellen wurden während seiner Zeit neu besetzt. Weitere Projekte mit der Staatsoper sind zunächst nicht geplant, sein Nachfolger Johannes Knecht soll die Möglichkeit habe, seine eigenen Vorstellungen ungestört zu verwirklichen. Eine graue Eminenz will Alber auf gar keinen Fall sein. Ein großes Abschiedsfest für den Chor gibt es natürlich auch. „Mit Buffet und allem Drum und Dran.“ Da wird sich der Blues dann schon verziehen. (Stuttgarter Zeitung)


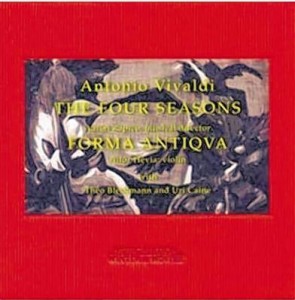 Vor 25 Jahren hätte man eine solche Aufnahme noch als das Werk von Verrückten abgetan. Der Beginn des Winters in dieser Neuaufnahme von Vivaldis „4 Jahreszeiten“ durch das spanische Ensemble Forma Antiqva etwa klingt in der Geräuschhaftigkeit, mit der die Streicher hier mehr auf als am Steg spielend die vor Kälte klirrende Landschaft evozieren, eher wie ein Stück neuer Musik als wie ein barockes Concerto grosso, der Frühlingssturm bläst gar als veritabler Orkan aus den Boxen. Man kann die Interpretationsgeschichte dieses Dauerbrenners unter den Vorzeichen historischer Aufführungspraxis durchaus als eine der Steigerung betrachten – mit immer extremeren Tempi und einer zunehmend naturalistischer werdenden Darstellung von Außermusikalischem wie Hundegebell oder Vogelrufen. Unter diesem Aspekt könnte diese Aufnahme nun das vorerst letzte Kapitel dieser Entwicklung sein, denn mehr Virtuosität und klangfarbliche Zuspitzung lässt sich dem Instrumentarium kaum noch abtrotzen. Auch was Agogik und Phrasierung anbelangt, dehnt das Ensemble um das spanische Brüdertrio Aarón, Daniel und Pablo Zapico hier die Partitur bis an die Grenzen aus – mitunter scheint sich der Rhythmus fast in freie, fast improvisatorisch wirkende Passagen aufzulösen. Eine in ihrer Radikalität und theaterhaft plastischen Darstellung nachhaltig faszinierende Einspielung. Möglich wurde sie durch eine extrem reduzierte Streicherbesetzung , kontrastiert von einem vergleichsweise üppig besetzten Continuo und gekrönt vom wie entfesselt spielenden Solisten Aitor Hevia. Streiten kann man sich über die musikalischen Einrichtungen der Sonette, die Vivaldi den einzelnen Sätzen vorangestellt hat und die von Uri Caine unter Zuhilfenahme elektronischer Klangerzeuger vertont wurden. Originell ist diese Aufnahme ohnehin.
Vor 25 Jahren hätte man eine solche Aufnahme noch als das Werk von Verrückten abgetan. Der Beginn des Winters in dieser Neuaufnahme von Vivaldis „4 Jahreszeiten“ durch das spanische Ensemble Forma Antiqva etwa klingt in der Geräuschhaftigkeit, mit der die Streicher hier mehr auf als am Steg spielend die vor Kälte klirrende Landschaft evozieren, eher wie ein Stück neuer Musik als wie ein barockes Concerto grosso, der Frühlingssturm bläst gar als veritabler Orkan aus den Boxen. Man kann die Interpretationsgeschichte dieses Dauerbrenners unter den Vorzeichen historischer Aufführungspraxis durchaus als eine der Steigerung betrachten – mit immer extremeren Tempi und einer zunehmend naturalistischer werdenden Darstellung von Außermusikalischem wie Hundegebell oder Vogelrufen. Unter diesem Aspekt könnte diese Aufnahme nun das vorerst letzte Kapitel dieser Entwicklung sein, denn mehr Virtuosität und klangfarbliche Zuspitzung lässt sich dem Instrumentarium kaum noch abtrotzen. Auch was Agogik und Phrasierung anbelangt, dehnt das Ensemble um das spanische Brüdertrio Aarón, Daniel und Pablo Zapico hier die Partitur bis an die Grenzen aus – mitunter scheint sich der Rhythmus fast in freie, fast improvisatorisch wirkende Passagen aufzulösen. Eine in ihrer Radikalität und theaterhaft plastischen Darstellung nachhaltig faszinierende Einspielung. Möglich wurde sie durch eine extrem reduzierte Streicherbesetzung , kontrastiert von einem vergleichsweise üppig besetzten Continuo und gekrönt vom wie entfesselt spielenden Solisten Aitor Hevia. Streiten kann man sich über die musikalischen Einrichtungen der Sonette, die Vivaldi den einzelnen Sätzen vorangestellt hat und die von Uri Caine unter Zuhilfenahme elektronischer Klangerzeuger vertont wurden. Originell ist diese Aufnahme ohnehin. Eigentlich gibt es kaum einen Grund, weshalb man Bachs Cembalo- oder Violinwerke ausgerechnet auf der Gitarre spielen sollte. Die Zahl überzeugender Originalaufnahmen ist groß und Transkriptionen von fremder Hand haftet leicht der Verdacht des Epigonalen an. Andererseits sind in den letzten Jahren einige Gitarreeinspielungen von Bachs Werken für Solovioline entstanden, denen man durchaus künstlerische Autonomie bescheinigen kann, etwa die Aufnahmen von Frank Bungarten für das Label Dabringhaus&Grimm. So war es wohl nur eine Frage der Zeit, wann sich der erste Gitarrist an die bachschen Solokonzerte wagen würde. Die in China geborene und in London lebende Gitarristin Xuefei Yang hat nun gleich drei davon für ihr Instrument eingerichtet – ein heikles Unterfangen, das man aber insgesamt als gelungen bezeichnen kann. Zwar hat sie ihr im Programmhefttext formuliertes Ziel, die Stücke so klingen zu lassen, als seien es „eigenständige Gitarrenwerke“ in ihrer Einrichtung des Cembalokonzerts BWV1052 verfehlt: zuviel sträubt sich da unüberhörbar gegen die Idiomatik der Gitarre. Dennoch: Mit welch technischer Bravour Xuefei Yang die horrenden Schwierigkeiten dieser Bearbeitung meistert, ist spektakulär. Selbst im dichtesten polyfonen Gestrüpp bleibt ihr Spiel transparent und schlüssig durchphrasiert, die solistische Besetzung des Orchestersatzes mit dem Elias String Quartet trägt das ihre zum lichten Gesamteindruck bei. Deutlich entspannter gelingen ihr die Violinkonzerte BWV1041 und BWV 1042, die über weite Strecken tatsächlich klingen, als hätte Bach sie für sechs Gitarrensaiten geschrieben. Und nur im Presto der ebenfalls eingespielten Sonate BWV1001 erliegt Yang einer alten Gitarristenkrankheit: die irre flinken Finger laufen da mitunter schneller, als es das Metrum verträgt.
Eigentlich gibt es kaum einen Grund, weshalb man Bachs Cembalo- oder Violinwerke ausgerechnet auf der Gitarre spielen sollte. Die Zahl überzeugender Originalaufnahmen ist groß und Transkriptionen von fremder Hand haftet leicht der Verdacht des Epigonalen an. Andererseits sind in den letzten Jahren einige Gitarreeinspielungen von Bachs Werken für Solovioline entstanden, denen man durchaus künstlerische Autonomie bescheinigen kann, etwa die Aufnahmen von Frank Bungarten für das Label Dabringhaus&Grimm. So war es wohl nur eine Frage der Zeit, wann sich der erste Gitarrist an die bachschen Solokonzerte wagen würde. Die in China geborene und in London lebende Gitarristin Xuefei Yang hat nun gleich drei davon für ihr Instrument eingerichtet – ein heikles Unterfangen, das man aber insgesamt als gelungen bezeichnen kann. Zwar hat sie ihr im Programmhefttext formuliertes Ziel, die Stücke so klingen zu lassen, als seien es „eigenständige Gitarrenwerke“ in ihrer Einrichtung des Cembalokonzerts BWV1052 verfehlt: zuviel sträubt sich da unüberhörbar gegen die Idiomatik der Gitarre. Dennoch: Mit welch technischer Bravour Xuefei Yang die horrenden Schwierigkeiten dieser Bearbeitung meistert, ist spektakulär. Selbst im dichtesten polyfonen Gestrüpp bleibt ihr Spiel transparent und schlüssig durchphrasiert, die solistische Besetzung des Orchestersatzes mit dem Elias String Quartet trägt das ihre zum lichten Gesamteindruck bei. Deutlich entspannter gelingen ihr die Violinkonzerte BWV1041 und BWV 1042, die über weite Strecken tatsächlich klingen, als hätte Bach sie für sechs Gitarrensaiten geschrieben. Und nur im Presto der ebenfalls eingespielten Sonate BWV1001 erliegt Yang einer alten Gitarristenkrankheit: die irre flinken Finger laufen da mitunter schneller, als es das Metrum verträgt.