Chopin mit Zuckerguss
Es gibt diese hübsche Geschichte über Alan Rusbridger, dem Chefredakteur der britischen Tageszeitung „Guardian“. Der Hobbypianist hatte sich zum Ziel gesetzt, innerhalb eines Jahres Chopins Ballade Nr. 1 g-Moll zu lernen – ein ziemlich berühmtes, aber auch ziemlich schwieriges Stück. Rusbridger jedenfalls übte und übte und bekam es schließlich, nicht zuletzt durch die Unterstützung von Pianisten wie Alfred Brendel oder Murray Perahia, hin. Es konnte das Stück spielen.
Aber was heißt das: Spielen können? Die richtigen Tasten zu treffen ist das eine. Doch ein Stück in seinem Gehalt zu erfassen und diesen pianistisch adäquat umzusetzen etwas anderes, und hier sind wir bei Olga Scheps, die mit jener g-Moll-Ballade ihren Klavierabend im Beethovensaal eröffnete. Natürlich verfügt die ECHO-Preisträgerin über unvergleichlich größere technische Möglichkeiten als ein Hobbypianist. Aber ob sie das Stück wirklich erfasst hat, ist die Frage, und in diesem Zusammenhang ist ein Zitat Murray Perahias interessant, der Rusbridger gegenüber geäußert haben soll, am Ende der Ballade würden sich „die Leichen aus ihren Gräbern erheben“ – eine treffende Metapher ist für die völlige Entfesselung, die sich hier ereignet. Davon nun war bei Olga Scheps kaum etwas zu spüren.
Zweifellos kann Olga Scheps wunderbar phrasieren, ihre Melodiebögen atmen und sind organisch gestaltet. Doch sie neigt dazu, es zu übertreiben, die schönen Stellen zu zelebrieren, von denen es in Chopins Musik viele gibt und sie mit einem als Poesie getarnten Zuckerguss zu überziehen. Das hat etwas Kalkuliertes, Manieriertes, vor allem aber überschreitet Olga Scheps damit nie die Grenzen jener emotionalen Wohlfühlzone, außerhalb derer es ungemütlich werden kann.
Auch Chopins Sonate Nr. 3 h-Moll zerfällt Olga Scheps in hübsch ausformulierte Einzelmomente, in ein eindimensionales Pasticcio aus „schönen“ und „virtuosen“ Stellen, das diese Musik weit unter Wert verkauft. Nun war Chopin immer in Gefahr, als Salonromantiker missverstanden zu werden, trotz Pianisten wie Pollini, Zimerman oder Trifonov, die ganz andere Facetten in seiner Musik offenlegen. Doch liegt Olga Scheps damit durchaus im Trend: auch Khatia Buniatishvili, ein anderes angesagtes Klaviergirlie, pflegt einen derart reduzierten Stil, der ja möglicherweise heutigen Hörgewohnheiten Rechnung trägt.
Auch nach der Pause ändert sich das Bild nicht groß: ein belangloser Rachmaninov („La Follia“-Variationen) und schließlich Prokofievs siebte Sonate, in dessen „Precipitato“-Finale sie immerhin ahnen lässt, dass sie auch zu Härte und kühler Präzision in der Lage sein kann. (STZN)
Russischer Wunderpianist
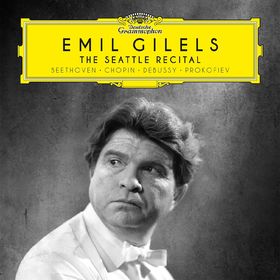 Am 16. Oktober wäre er 100 Jahre geworden: Emil Gilels, der zusammen mit Sviatoslav Richter als der bedeutendste russische Pianist der Nachkriegszeit gilt. Nach Stalins Tod war Gilels 1955 der erste sowjetische Künstler, der auf eine Amerikatournee geschickt wurde, bis 1983 reiste er insgesamt zwölfmal durch die USA. „Ich habe“, so Gilels, „den USA nicht nur mein Herz, sondern auch einen Großteil meiner Lebenszeit geschenkt“. Nun gab es auch im Westen gute Pianisten, doch Gilels ungeheure technische Souveränität, gepaart mit Kraft und Empfindsamkeit, muss damals überwältigend gewirkt haben. Dass er ein Live-Künstler war, der im Konzert über sich hinauswachsen konnte, lässt sich inzwischen anhand des Mitschnitts eines Recitals nachvollziehen, das Gilels 1964 in Seattle gegeben hat. Er beginnt mit Beethovens Waldsteinsonate, einem seiner Paradestücke, feurig, zupackend aber sehr beherrscht, gefolgt von Chopins Variationen über „Là ci darem la mano“ – reines Virtuosenfutter, das Gilels mit spürbarer Lust am Risiko spielt. Danach ist das Publikum euphorisiert, erst recht nach Prokofjevs fulminant hingelegter 3. Sonate. Gilels, das spürt man, will seinem Ruf als Wunderpianist gerecht werden, gleichwohl kommen uns heute manche Interpretationen vielleicht etwas merkwürdig vor. „Reflets dans l´eau“ aus Debussys „Images I“ erscheint in seiner vordergründig rauschenden Motorik eher auf Bravour denn auf Atmosphäre angelegt. Gilels klangliche Fähigkeiten lassen sich ohnehin besser auf anderen Aufnahmen beurteilen: die Tonqualität dieses (Mono-)Mitschnitts ist insgesamt dürftig.
Am 16. Oktober wäre er 100 Jahre geworden: Emil Gilels, der zusammen mit Sviatoslav Richter als der bedeutendste russische Pianist der Nachkriegszeit gilt. Nach Stalins Tod war Gilels 1955 der erste sowjetische Künstler, der auf eine Amerikatournee geschickt wurde, bis 1983 reiste er insgesamt zwölfmal durch die USA. „Ich habe“, so Gilels, „den USA nicht nur mein Herz, sondern auch einen Großteil meiner Lebenszeit geschenkt“. Nun gab es auch im Westen gute Pianisten, doch Gilels ungeheure technische Souveränität, gepaart mit Kraft und Empfindsamkeit, muss damals überwältigend gewirkt haben. Dass er ein Live-Künstler war, der im Konzert über sich hinauswachsen konnte, lässt sich inzwischen anhand des Mitschnitts eines Recitals nachvollziehen, das Gilels 1964 in Seattle gegeben hat. Er beginnt mit Beethovens Waldsteinsonate, einem seiner Paradestücke, feurig, zupackend aber sehr beherrscht, gefolgt von Chopins Variationen über „Là ci darem la mano“ – reines Virtuosenfutter, das Gilels mit spürbarer Lust am Risiko spielt. Danach ist das Publikum euphorisiert, erst recht nach Prokofjevs fulminant hingelegter 3. Sonate. Gilels, das spürt man, will seinem Ruf als Wunderpianist gerecht werden, gleichwohl kommen uns heute manche Interpretationen vielleicht etwas merkwürdig vor. „Reflets dans l´eau“ aus Debussys „Images I“ erscheint in seiner vordergründig rauschenden Motorik eher auf Bravour denn auf Atmosphäre angelegt. Gilels klangliche Fähigkeiten lassen sich ohnehin besser auf anderen Aufnahmen beurteilen: die Tonqualität dieses (Mono-)Mitschnitts ist insgesamt dürftig.
Emil Gilels. The Seattle Recital. DG 4796288.
Auf der Stuhlkante
24 Jahre alt war Béla Bartók, als er sich, ausgestattet mit Spazierstock, Rucksack und Phonograph 1905 von Budapest aus in die Weiten des Königreichs Ungarn aufmachte, um die Musik der Bauern und Landleute zu erforschen. Ein Unternehmen, das für Bartók zum Lebenswerk wurde, das er schließlich mit einer umfangreichen Anthologie der Volksgesänge seiner Heimat krönte. Einige dieser Tänze und Melodien hat Bartók auch in eigenen Kompositionen verarbeitet, zu den berühmtesten zählen die Rumänischen Volkstänze Sz 68, die das Norwegische Kammerorchester nun bei seinem Gastspiel innerhalb der Reihe Faszination Klassik im Beethovensaal gespielt hat. An diesen kurzen, zu einer Siebenergruppe zusammengefassten Tänzen wird Bartóks große Kunst deutlich, das Authentische dieser dem Volk abgelauschten Klänge trotz ihrer Transplantation in die Welt der Kunstmusik bewahrt zu haben. Musik, die in erster Linie vom Rhythmus lebt und vom Norwegischen Kammerorchester unter seinem charismatischen Konzertmeister Terje Tønnesen mit dem angemessenen Schwung wie einer passenden Prise rustikalem Charme gespielt wurde.
Es ist vor allem die größere Beweglichkeit, die (gute) Kammerorchester großen Sinfonieorchestern voraus haben – ein kleines Schiffchen lässt sich nun mal leichter manövrieren als ein Tanker, und diese Qualität haben die Norweger ganz besonders kultiviert. Leicht und rhythmisch wendig ist ihr Musizieren, auch bei Mozarts g-Moll-Sinfonie KV 550, über die der Dirigent Nikolaus Harnoncourt einmal bemerkte, es gehe darin um „Leben und Tod“. Eine Einstellung, die auch das Norwegische Kammerorchester zu teilen scheint – bedenkt man den dringlichen Tonfall, den das Orchester hier von Beginn an anschlug. Ein Musizieren auf der sprichwörtlichen Stuhlkante, mit glasklar ausformulierten Phrasen, organisch gestalteten Übergängen und dramatischen Verdichtungen in den Durchführungsteilen, klanglich geschärft nicht zuletzt durch weitgehenden Verzicht auf Vibrato. Das hätte wohl auch Harnoncourt gefallen, ebenso wie die beiden Hornkonzerte von Mozart und Haydn, die der junge Hornist Felix Klieser ganz fabelhaft gespielt hat. Klieser wurde nicht zuletzt deshalb bekannt, da er, ohne Arme geboren, die Hornventile mit den Füßen betätigt, was allein durch die Haltung – der rechte Fuß befindet sich beim Spiel auf Schulterhöhe – fast etwas Artistisches hat. Doch abgesehen davon überzeugte Klieser nicht nur durch seine saubere Technik sondern auch durch seine profunde Musikalität. Der Beifall im sehr gut besuchten Saal war jedenfalls herzlich, Klieser bedankte sich mit Rossinis „Le Rendez-vous de chasse“, und auch das Orchester gab dem Publikum am Ende noch ein klingendes Visitenkärtchen aus seiner Heimat mit auf den Weg: „Våren“ (Frühling) aus den „Zwei elegischen Melodien“ von Edvard Grieg. (STZN)
„Männerabend“ war Kult. Zehn Jahre lang spielten Martin Luding und Roland Baisch die schrille Revue über Tom, der sich, nachdem ihn seine Heike sitzengelassen hat, auf ins Reich männlicher Neurosen und Absonderlichkeiten begibt und dabei allerhand merkwürdigen Typen begegnet. Ein Dauerbrenner, den allein im Theaterhaus an die 200.000 Zuschauer gesehen haben. Nun hatte im ausverkauften T2 des Theaterhauses der Nachfolger „Männerabend 2 – Letzte Ausfahrt Bali“ seine heftig akklamierte Premiere – die Prognose dürfte nicht allzu gewagt sein, dass auch dem neuen Programm ein ähnlicher Erfolg beschieden sein wird.
Wiederum beruht die Rahmenhandlung darauf, dass Heike weg ist – und Tom allein. Anders als im ersten „Männerabend“ ist Heike aber nicht mit ihrem Snowboardlehrer Giovanni durchgebrannt, sondern nimmt dank göttlicher Weisung eine Auszeit auf Bali. Wie es dazu kam? Nun ja, in einer Art Prolog fährt das Paar auf der Autobahn. Heike sitzt am Steuer, bei Tempo 240 passiert ein Crash, bei dem auch ein Hase dran glauben muss, und flugs findet sich Tom an der Himmelspforte wieder, wo er von einem rauschebärtigen Herrgott verkündet bekommt, dass er sechs Tage Zeit habe, „aus einer Beziehung eine Liebe zu machen“. In dieser Zeit habe er, offenbar als Strafe für sein Machotum, die Rolle von Heike zu übernehmen. Falls Tom scheitern sollte, werde er verbannt – nach Paderborn.
Das mag alles ein bisschen konstruiert klingen, doch Logik ist hier eher zweitrangig. Nachdem Tom jedenfalls realisiert hat, dass er von seiner Umgebung wirklich als Heike wahrgenommen wird, beginnt er sich mit seiner neuen Rolle zu arrangieren – ein dramaturgisch fruchtbarer Perspektivenwechsel, der im weiteren Verlauf zu allerhand heiteren Verwirrungen führt. So muss Heike alias Tom akzeptieren, dass ihre Karriere als Moderatorin der Sendung „Der grüne Daumen“ aus Altersgründen beendet ist und ihre Rolle von dem „französischen Starmoderator“ Jacques Le Dic (!) übernommen wird. Wer mutmaßt, mit dem Nachnamen könnten sexuelle Anspielungen verbunden sein, findet sich schnell bestätigt: französisch, so bekundet der baskenbemützte Schnösel, sei eben nicht nur gleichbedeutend mit la „grande nation“, sondern auch mit „die schönste Position“. Und ein formschönes Baguette, so erfährt man, muss nicht allein zum Essen dienen….
Es mag erstaunen, dass mit derlei Zoten immer noch Lachsalven provoziert werden können. Doch wer die Programme von Baisch und Luding kennt, weiß, dass das humoristische Spektrum zwischen feinsinnig und rustikal in jede Richtung ausgeschritten wird und auch derber Klamauk seinen Platz hat. Über abgestandene Wortwitze wie den vom Feuermeldergesicht („Einschlagen und wegrennen“) kann man müde lächeln, die Szene mit der versoffenen Mutter („Ich habe mein Jäckchen vergessen – Konjäckchen!“) hätte wohl auch Heinz Schenk im Blauen Bock gefallen. Doch in ihren besten Szenen entwickeln sie dann wieder eine anarchische Überdrehtheit, die an die legendäre britische Komikertruppe Monty Python erinnert, wobei sich gerade Roland Baisch als Knallcharge zu profilieren weiß. Etwa in der Rolle des balinesischen Hotelrezeptionisten Naggedei Goreng, wo er den zeitgeistigen Wellness- und Lifestylejargon grandios auf die Schippe nimmt. Oder als Maskenbildner Bruno, der eigentlich Eberhard heißt und so tun muss, als sei er schwul („Sonst kriegt man als Maskenbildner keinen Job“). Immer wieder schön auch Baischs Einlagen als Johnny Cash-Verschnitt in Goldsakko und Cowboyhut.
So geht der Abend dann doch sehr kurzweilig dahin. Am Ende hat Tom seine Prüfung, nicht zuletzt dank tatkräftiger Unterstützung des Erzengels Gunter Gabriel bestanden und darf nach Bali zu seiner Heike zum Wellnessen. What a good massage! Äh, message… (STZN)

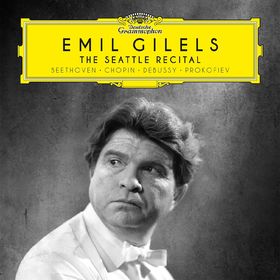 Am 16. Oktober wäre er 100 Jahre geworden: Emil Gilels, der zusammen mit Sviatoslav Richter als der bedeutendste russische Pianist der Nachkriegszeit gilt. Nach Stalins Tod war Gilels 1955 der erste sowjetische Künstler, der auf eine Amerikatournee geschickt wurde, bis 1983 reiste er insgesamt zwölfmal durch die USA. „Ich habe“, so Gilels, „den USA nicht nur mein Herz, sondern auch einen Großteil meiner Lebenszeit geschenkt“. Nun gab es auch im Westen gute Pianisten, doch Gilels ungeheure technische Souveränität, gepaart mit Kraft und Empfindsamkeit, muss damals überwältigend gewirkt haben. Dass er ein Live-Künstler war, der im Konzert über sich hinauswachsen konnte, lässt sich inzwischen anhand des Mitschnitts eines Recitals nachvollziehen, das Gilels 1964 in Seattle gegeben hat. Er beginnt mit Beethovens Waldsteinsonate, einem seiner Paradestücke, feurig, zupackend aber sehr beherrscht, gefolgt von Chopins Variationen über „Là ci darem la mano“ – reines Virtuosenfutter, das Gilels mit spürbarer Lust am Risiko spielt. Danach ist das Publikum euphorisiert, erst recht nach Prokofjevs fulminant hingelegter 3. Sonate. Gilels, das spürt man, will seinem Ruf als Wunderpianist gerecht werden, gleichwohl kommen uns heute manche Interpretationen vielleicht etwas merkwürdig vor. „Reflets dans l´eau“ aus Debussys „Images I“ erscheint in seiner vordergründig rauschenden Motorik eher auf Bravour denn auf Atmosphäre angelegt. Gilels klangliche Fähigkeiten lassen sich ohnehin besser auf anderen Aufnahmen beurteilen: die Tonqualität dieses (Mono-)Mitschnitts ist insgesamt dürftig.
Am 16. Oktober wäre er 100 Jahre geworden: Emil Gilels, der zusammen mit Sviatoslav Richter als der bedeutendste russische Pianist der Nachkriegszeit gilt. Nach Stalins Tod war Gilels 1955 der erste sowjetische Künstler, der auf eine Amerikatournee geschickt wurde, bis 1983 reiste er insgesamt zwölfmal durch die USA. „Ich habe“, so Gilels, „den USA nicht nur mein Herz, sondern auch einen Großteil meiner Lebenszeit geschenkt“. Nun gab es auch im Westen gute Pianisten, doch Gilels ungeheure technische Souveränität, gepaart mit Kraft und Empfindsamkeit, muss damals überwältigend gewirkt haben. Dass er ein Live-Künstler war, der im Konzert über sich hinauswachsen konnte, lässt sich inzwischen anhand des Mitschnitts eines Recitals nachvollziehen, das Gilels 1964 in Seattle gegeben hat. Er beginnt mit Beethovens Waldsteinsonate, einem seiner Paradestücke, feurig, zupackend aber sehr beherrscht, gefolgt von Chopins Variationen über „Là ci darem la mano“ – reines Virtuosenfutter, das Gilels mit spürbarer Lust am Risiko spielt. Danach ist das Publikum euphorisiert, erst recht nach Prokofjevs fulminant hingelegter 3. Sonate. Gilels, das spürt man, will seinem Ruf als Wunderpianist gerecht werden, gleichwohl kommen uns heute manche Interpretationen vielleicht etwas merkwürdig vor. „Reflets dans l´eau“ aus Debussys „Images I“ erscheint in seiner vordergründig rauschenden Motorik eher auf Bravour denn auf Atmosphäre angelegt. Gilels klangliche Fähigkeiten lassen sich ohnehin besser auf anderen Aufnahmen beurteilen: die Tonqualität dieses (Mono-)Mitschnitts ist insgesamt dürftig.